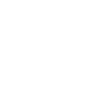In den letzten 50 Jahren ist der weltweite Stromverbrauch kontinuierlich gestiegen und wird im Jahr 2021 voraussichtlich rund 25.300 Terawattstunden erreichen. Mit dem Übergang zu Industrie 4.0 steigt der Energiebedarf weltweit. Diese Zahlen nehmen jährlich zu, wobei der Energiebedarf der Industrie und anderer Wirtschaftszweige noch nicht berücksichtigt ist. Dieser industrielle Wandel und der hohe Stromverbrauch gehen mit spürbaren Auswirkungen des Klimawandels aufgrund übermäßiger Treibhausgasemissionen einher. Derzeit sind die meisten Kraftwerke und Anlagen zur Deckung dieses Bedarfs stark von fossilen Brennstoffen (Öl und Gas) abhängig. Diese Klimaproblematik verhindert eine zusätzliche Energieerzeugung mit konventionellen Methoden. Daher ist die Entwicklung effizienter und zuverlässiger Energiespeichersysteme immer wichtiger geworden, um eine kontinuierliche und zuverlässige Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen zu gewährleisten.
Der Energiesektor hat mit einem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien bzw. „grüner“ Lösungen reagiert. Verbesserte Fertigungstechniken haben diesen Wandel begünstigt und beispielsweise zu einer effizienteren Produktion von Windkraftanlagenflügeln geführt. Auch die Effizienz von Photovoltaikzellen konnte verbessert werden, was zu einer höheren Energieausbeute pro Nutzungsfläche führte. Im Jahr 2021 stieg die Stromerzeugung aus Solaranlagen (Photovoltaik, PV) deutlich an und erreichte einen Rekordwert von 179 TWh, was einem Wachstum von 22 % gegenüber 2020 entspricht. Die Solartechnologie deckt mittlerweile 3,6 % der weltweiten Stromerzeugung ab und ist nach Wasserkraft und Windkraft die drittgrößte erneuerbare Energiequelle.
Diese Fortschritte lösen jedoch nicht alle systembedingten Nachteile erneuerbarer Energiesysteme, insbesondere deren Verfügbarkeit. Die meisten dieser Methoden produzieren Energie nicht bedarfsgerecht wie Kohle- und Ölkraftwerke. Solarenergie beispielsweise ist zwar tagsüber verfügbar, ihre Leistung schwankt jedoch je nach Sonneneinstrahlung und Ausrichtung der Photovoltaikmodule. Nachts wird keine Energie erzeugt, und im Winter sowie an stark bewölkten Tagen ist die Leistung deutlich reduziert. Auch Windkraft unterliegt Schwankungen in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit. Daher müssen diese Lösungen mit Energiespeichersystemen kombiniert werden, um die Energieversorgung in Zeiten geringer Leistung sicherzustellen.
Was sind Energiespeichersysteme?
Energiespeichersysteme speichern Energie, um sie später zu nutzen. In manchen Fällen findet eine Energieumwandlung zwischen gespeicherter und abgegebener Energie statt. Das bekannteste Beispiel sind elektrische Batterien wie Lithium-Ionen- oder Bleiakkumulatoren. Sie liefern elektrische Energie durch chemische Reaktionen zwischen den Elektroden und dem Elektrolyten.
Batterien, auch Batteriespeichersysteme genannt, stellen die gängigste Energiespeichermethode im Alltag dar. Es gibt aber auch andere Speichersysteme, wie beispielsweise Wasserkraftwerke, die die potenzielle Energie des in einem Stausee gespeicherten Wassers in elektrische Energie umwandeln. Das herabstürzende Wasser treibt das Schwungrad einer Turbine an, die so Strom erzeugt. Ein weiteres Beispiel ist komprimiertes Gas: Beim Austritt treibt das Gas das Rad einer Turbine an und erzeugt dadurch Strom.
Batterien unterscheiden sich von anderen Speichermethoden durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Von kleinen Geräten und der Stromversorgung von Fahrzeugen bis hin zu Haushaltsanwendungen und großen Solarparks lassen sich Batterien nahtlos in jede netzunabhängige Speicherlösung integrieren. Wasserkraft und Druckluftspeicher hingegen erfordern sehr große und komplexe Infrastrukturen. Dies führt zu sehr hohen Kosten, die nur bei sehr großen Anwendungen wirtschaftlich sinnvoll sind.
Anwendungsfälle für netzunabhängige Speichersysteme.
Wie bereits erwähnt, können netzunabhängige Speichersysteme die Nutzung und Abhängigkeit von erneuerbaren Energiequellen wie Solar- und Windkraft erleichtern. Darüber hinaus gibt es weitere Anwendungsbereiche, die von solchen Systemen erheblich profitieren können.
Städtische Stromnetze sind darauf ausgelegt, die benötigte Strommenge entsprechend Angebot und Nachfrage jeder Stadt bereitzustellen. Der Strombedarf kann im Tagesverlauf schwanken. Inselspeichersysteme werden eingesetzt, um diese Schwankungen abzufedern und bei Bedarfsspitzen für mehr Stabilität zu sorgen. Darüber hinaus sind Inselspeichersysteme äußerst vorteilhaft, um unvorhergesehene technische Störungen im Hauptstromnetz oder planmäßige Wartungsarbeiten zu überbrücken. Sie können den Strombedarf decken, ohne dass alternative Energiequellen gesucht werden müssen. Ein Beispiel hierfür ist der Eissturm in Texas Anfang Februar 2023, der rund 262.000 Menschen ohne Strom zurückließ, während sich die Reparaturen aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen verzögerten.
Elektrofahrzeuge stellen ein weiteres Anwendungsgebiet dar. Forscher haben viel Aufwand betrieben, um die Batterieherstellung und Lade-/Entladestrategien zu optimieren und so die Lebensdauer und Energiedichte von Batterien zu erhöhen. Lithium-Ionen-Batterien spielten dabei eine Vorreiterrolle und werden in neuen Elektroautos, aber auch in Elektrobussen, umfassend eingesetzt. Verbesserte Batterien können in diesem Fall – mit den richtigen Technologien – nicht nur eine größere Reichweite, sondern auch kürzere Ladezeiten ermöglichen.
Andere technologische Fortschritte wie unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) und mobile Roboter haben stark von der Batterieentwicklung profitiert. Ihre Bewegungs- und Steuerungsstrategien hängen maßgeblich von der Batteriekapazität und der bereitgestellten Leistung ab.
Was ist ein BESS?
Ein Batteriespeichersystem (BESS) dient der Speicherung von Energie. Diese Energie kann aus dem Stromnetz oder aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Solarenergie stammen. Es besteht aus mehreren Batterien, die in unterschiedlichen Konfigurationen (seriell/parallel) angeordnet und je nach Bedarf dimensioniert sind. Sie sind an einen Wechselrichter angeschlossen, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Ein Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht den Zustand der Batterien sowie den Lade- und Entladevorgang.
Im Vergleich zu anderen Energiespeichersystemen sind sie besonders flexibel in Bezug auf Platzierung und Anschluss und benötigen keine teure Infrastruktur, verursachen aber dennoch beträchtliche Kosten und erfordern je nach Nutzung eine regelmäßigere Wartung.
BESS-Dimensionierung und Nutzungsgewohnheiten
Ein entscheidender Punkt bei der Installation eines Batteriespeichersystems ist die Dimensionierung. Wie viele Batterien werden benötigt? In welcher Konfiguration? In manchen Fällen kann der Batterietyp langfristig eine entscheidende Rolle für Kosteneinsparungen und Effizienz spielen.
Dies geschieht von Fall zu Fall, da die Anwendungsbereiche von kleinen Haushalten bis hin zu großen Industrieanlagen reichen können.
Die gängigste erneuerbare Energiequelle für kleine Haushalte, insbesondere in städtischen Gebieten, ist Solarenergie mittels Photovoltaik-Anlagen. Der Ingenieur berücksichtigt dabei in der Regel den durchschnittlichen Stromverbrauch des Haushalts und ermittelt die jährliche Sonneneinstrahlung am jeweiligen Standort. Die Anzahl der Batterien und deren Netzkonfiguration werden so gewählt, dass der Strombedarf des Haushalts während der Phase mit der geringsten Sonneneinstrahlung gedeckt wird, ohne die Batterien vollständig zu entladen. Dies setzt eine vollständige Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz voraus.
Einen relativ moderaten Ladezustand der Batterien beizubehalten oder sie nicht vollständig zu entladen, mag zunächst kontraintuitiv erscheinen. Schließlich, wozu ein Speichersystem nutzen, wenn man sein volles Potenzial nicht ausschöpfen kann? Theoretisch ist dies möglich, aber es ist möglicherweise nicht die Strategie, die den Return on Investment maximiert.
Einer der Hauptnachteile von Batteriespeichersystemen (BESS) sind die relativ hohen Batteriekosten. Daher ist die Wahl eines Nutzungsverhaltens bzw. einer Lade-/Entladestrategie, die die Batterielebensdauer maximiert, unerlässlich. Bleiakkumulatoren beispielsweise dürfen nicht unter 50 % ihrer Kapazität entladen werden, ohne irreversible Schäden zu erleiden. Lithium-Ionen-Akkus weisen eine höhere Energiedichte und eine lange Lebensdauer auf. Sie können auch in größeren Entladebereichen entladen werden, was jedoch mit höheren Kosten verbunden ist. Die Kostenunterschiede zwischen verschiedenen Batterietypen sind erheblich; Bleiakkumulatoren können Hunderte bis Tausende von Dollar günstiger sein als Lithium-Ionen-Akkus gleicher Größe. Aus diesem Grund werden Bleiakkumulatoren in Solaranlagen in Entwicklungsländern und armen Gemeinden am häufigsten eingesetzt.
Die Leistung einer Batterie wird im Laufe ihrer Lebensdauer stark durch Alterungsprozesse beeinträchtigt. Sie weist keine konstante Leistung auf, die mit einem plötzlichen Ausfall endet. Stattdessen nimmt die Kapazität allmählich ab. In der Praxis gilt eine Batterie als erschöpft, wenn ihre Kapazität nur noch 80 % ihrer ursprünglichen Kapazität beträgt, also einen Kapazitätsverlust von 20 % aufweist. Dies bedeutet, dass weniger Energie bereitgestellt werden kann. Dadurch können sich die Nutzungsdauer vollständig autarker Systeme und die Reichweite eines Elektrofahrzeugs verringern.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherheit. Dank Fortschritten in der Fertigung und Technologie sind moderne Batterien im Allgemeinen chemisch stabiler. Aufgrund von Alterungsprozessen und unsachgemäßer Behandlung können Zellen jedoch thermisch durchgehen, was katastrophale Folgen haben und in manchen Fällen sogar das Leben der Verbraucher gefährden kann.
Aus diesem Grund haben Unternehmen bessere Batterieüberwachungssoftware (BMS) entwickelt, um nicht nur den Batterieverbrauch zu kontrollieren, sondern auch den Gesundheitszustand zu überwachen, um rechtzeitig Wartungsarbeiten durchführen und schwerwiegendere Folgen vermeiden zu können.
Abschluss
Netzenergiespeichersysteme bieten eine hervorragende Möglichkeit, die Unabhängigkeit vom Hauptnetz zu erreichen und gleichzeitig als Notstromversorgung in Zeiten von Stromausfällen und Lastspitzen zu dienen. Ihre Weiterentwicklung würde den Übergang zu umweltfreundlicheren Energiequellen erleichtern und somit die Auswirkungen der Energieerzeugung auf den Klimawandel begrenzen, während gleichzeitig der stetig steigende Energiebedarf gedeckt wird.
Batteriespeichersysteme sind die am weitesten verbreiteten und am einfachsten für verschiedene Alltagsanwendungen konfigurierbaren Energiespeicher. Ihre hohe Flexibilität steht jedoch im Widerspruch zu den relativ hohen Kosten, was die Entwicklung von Überwachungsstrategien zur Folge hat, um die Lebensdauer der jeweiligen Systeme so weit wie möglich zu verlängern. Industrie und Forschung investieren derzeit viel Zeit und Mühe in die Untersuchung und das Verständnis der Batteriealterung unter verschiedenen Bedingungen.